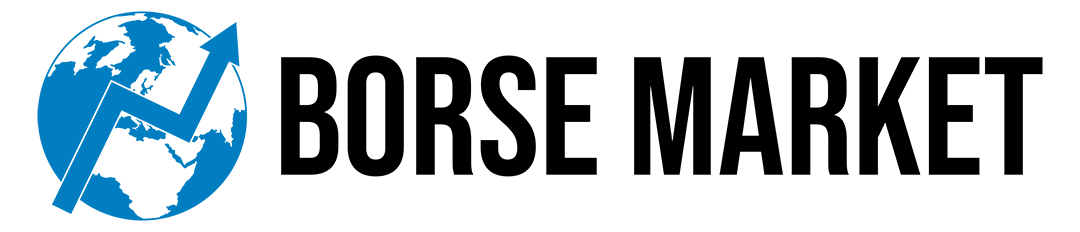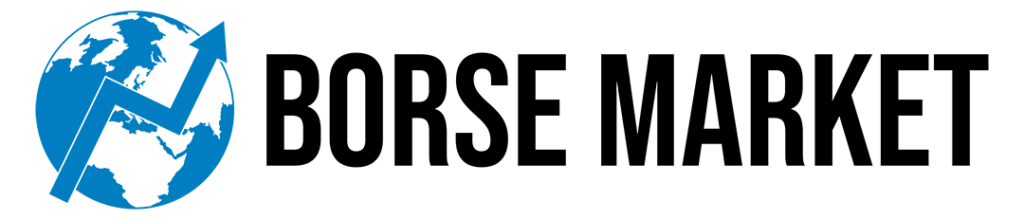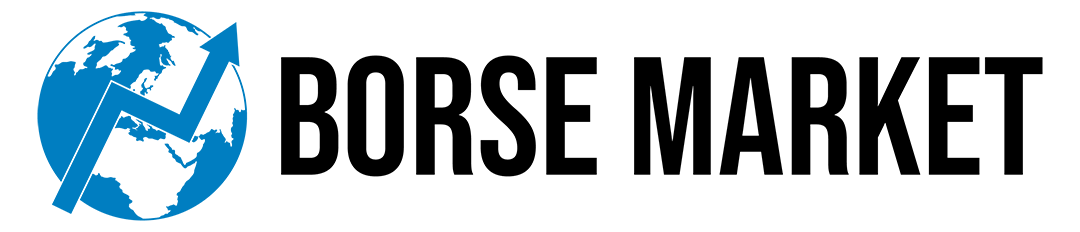Traditionsbetrieb nach 150 Jahren geschlossen
Das Rohrwerk Maxhütte im oberpfälzischen Sulzbach-Rosenberg hat seinen Betrieb nach mehr als eineinhalb Jahrhunderten Geschichte endgültig eingestellt. Insolvenzverwalter Jochen Zaremba erklärte, dass das Werk am Montag dichtgemacht wurde und die rund 300 Beschäftigten von ihren Aufgaben freigestellt seien. Für die Angestellten beginnen nun Verhandlungen über einen Sozialplan mit dem Betriebsrat.
Unklare Eigentumsverhältnisse blockierten Verkauf
Zaremba verwies auf die komplizierten Rahmenbedingungen, die eine Übernahme unmöglich gemacht hätten. „Die Anlagen gehörten nicht der insolventen Gesellschaft, sondern einem Dritten, dessen Preisvorstellungen nicht mit denen der Investoren vereinbar waren“, erklärte er. Damit zerschlugen sich Gespräche mit möglichen Käufern. Die Suche nach einem Investor blieb erfolglos.
Staatliche Hilfen ohne dauerhaften Erfolg
Die bayerische Staatsregierung hatte mehrfach versucht, den traditionsreichen Standort zu retten. Bereits 2002 war das Werk nach einem langwierigen Insolvenzverfahren stillgelegt worden, ehe der Bereich Rohrwerk abgespalten und weitergeführt wurde. Später unterstützte der Freistaat die Maxhütte mit 250 Millionen Euro, um die Produktion fortzuführen. Dennoch gelang es nicht, den Standort nachhaltig zu stabilisieren.
Symbol für den Niedergang der Stahlindustrie
Über viele Jahrzehnte war die Maxhütte ein Aushängeschild der deutschen Stahlbranche und zählte zu den größten Arbeitgebern in Bayern. Einst beschäftigte das Unternehmen mehrere tausend Menschen und prägte die Region wirtschaftlich wie gesellschaftlich. Die endgültige Schließung zeigt, wie sehr hohe Energiekosten, verschärfte Konkurrenz im Ausland und strukturelle Probleme der Industrie ihre Spuren hinterlassen haben.
Ungewisse Zukunft für die Belegschaft
Rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vom Ende des Rohrwerks betroffen. Der Insolvenzverwalter kündigte an, in den kommenden Wochen mit dem Betriebsrat Lösungen für Abfindungen und Unterstützung der Beschäftigten zu finden. Dennoch wird befürchtet, dass viele der Fachkräfte die Region verlassen müssen, um neue Arbeit zu finden.