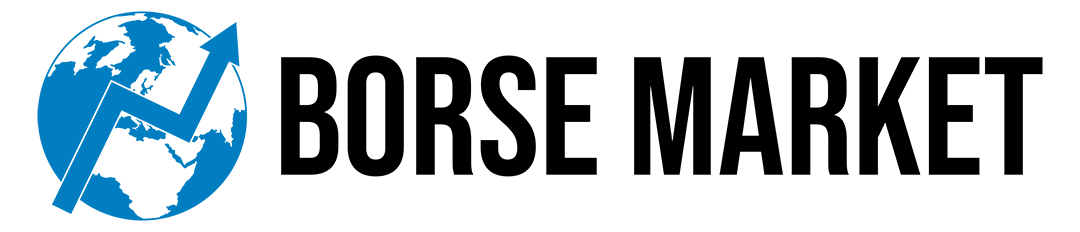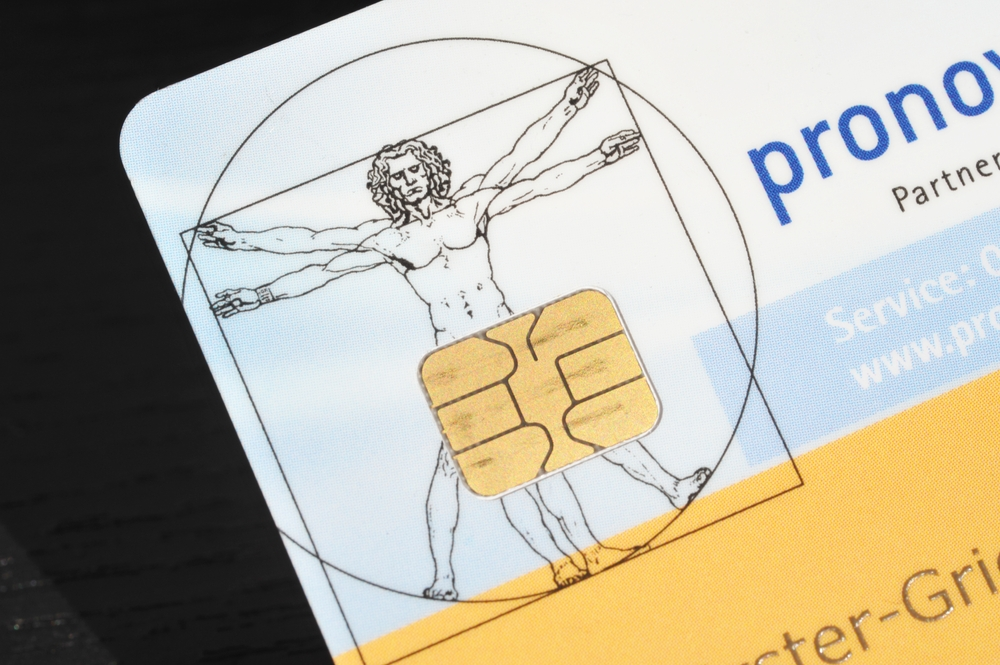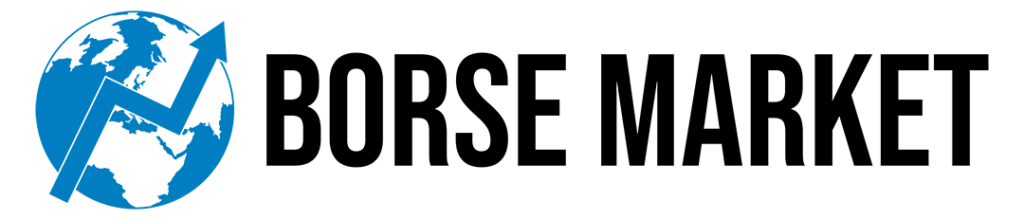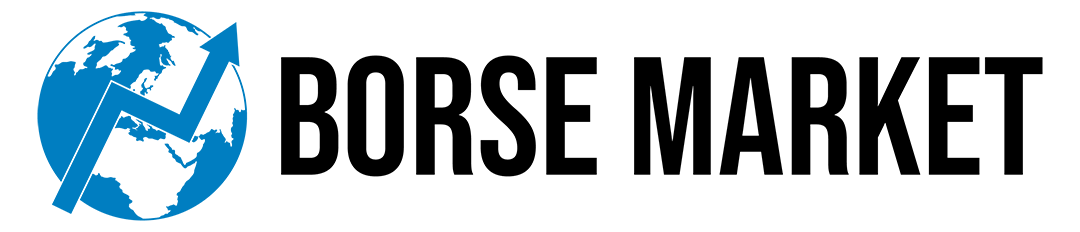Gesetzliche Kassen geraten zunehmend unter finanziellen Druck
Im Jahr 2026 steigen die Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung erneut – trotz politischer Bemühungen, die Belastung für Versicherte zu begrenzen. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag offiziell auf 2,9 Prozent festgelegt. Doch viele Krankenkassen warnen: Diese Zahl spiegelt nicht die Realität wider. In der Praxis dürfte der Beitrag für Millionen Versicherte höher ausfallen.
Nach Berechnungen des Schätzerkreises – bestehend aus Vertretern des Gesundheitsministeriums, des Bundesamtes für Soziale Sicherung und des GKV-Spitzenverbandes – wird das Defizit der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in den kommenden Jahren weiter wachsen. Die Ausgaben steigen deutlich schneller als die Einnahmen, was die Kassen in eine chronische Unterfinanzierung treibt.
Wie sich der Beitrag zusammensetzt
Der Krankenkassenbeitrag setzt sich aus zwei Teilen zusammen: einem einheitlichen Beitragssatz von 14,6 Prozent und dem individuellen Zusatzbeitrag, der von jeder Krankenkasse selbst bestimmt wird. Beide Anteile werden hälftig von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen.
Im Jahr 2025 liegt der durchschnittliche Zusatzbeitrag bei 2,5 Prozent, doch durch die Anpassung erhöht sich der Gesamtbeitrag ab 2026 auf etwa 17,5 Prozent des Bruttolohns. Für einen Arbeitnehmer mit 4.000 Euro Monatsgehalt bedeutet das Gesamtabzüge von rund 700 Euro für die Krankenversicherung – jeweils zur Hälfte getragen von beiden Seiten.
Kassen mit angespannten Finanzen werden laut Branchenexperten gezwungen sein, ihre Zusatzbeiträge auf über 3 Prozent anzuheben, um gesetzliche Rücklagen wieder aufzufüllen.
Regierung plant Milliarden-Einsparungen
Um die Beitragsexplosion zu verhindern, hat die Bundesregierung ein Sparpaket über zwei Milliarden Euro verabschiedet. Der Löwenanteil davon – 1,8 Milliarden Euro – entsteht durch eine geänderte Berechnungsgrundlage für die jährlichen Krankenhauszuschüsse. Diese Anpassung soll verhindern, dass die Krankenkassen steigende Klinikbudgets vollständig ausgleichen müssen.
Weitere 100 Millionen Euro sollen durch Einsparungen bei Verwaltungsausgaben erzielt werden. Die Kassen dürfen ihre Verwaltungskosten 2026 nur um maximal acht Prozent gegenüber 2024 erhöhen. Für Sachkosten – etwa für Büromaterial, Telekommunikation und Werbung – gilt ein Limit von zwei Prozent.
Auch der Innovationsfonds, der Projekte zur Verbesserung der medizinischen Versorgung finanziert, wird um 100 Millionen Euro gekürzt. Die Fördersumme sinkt damit von 200 auf 100 Millionen Euro. Laut Ministerin Warken seien viele Mittel aus den Vorjahren ohnehin noch nicht vollständig abgerufen worden.
Krankenkassen schlagen Alarm
Die Kassenverbände bezweifeln, dass das Sparpaket ausreicht, um den Kostenanstieg zu stoppen. Der BKK-Dachverband warnt vor einer „spürbaren Mehrbelastung der Beitragszahler“. Trotz der staatlichen Maßnahmen seien viele Versicherer gezwungen, ihre Beitragssätze zu erhöhen.
Laut Gesetz müssen die Krankenkassen 20 Prozent einer Monatsausgabe als Rücklage bilden. Derzeit liegt dieser Wert im Durchschnitt jedoch nur bei sechs Prozent. Bis Ende 2026 soll die Lücke geschlossen werden – ein Ziel, das nur mit zusätzlichen Beitragseinnahmen erreichbar ist.
„Ich halte es für unrealistisch, dass der durchschnittliche Zusatzbeitrag im kommenden Jahr bei 2,9 Prozent bleibt“, sagte Anne-Kathrin Klemm, Vorsitzende des BKK-Dachverbands. Auch der AOK-Bundesverband äußerte Skepsis. Dessen stellvertretender Vorstandschef Jens Martin Hoyer erklärte: „Das kurzfristig geschnürte Sparpaket wird kaum ausreichen, um die Ausgabensteigerungen in der GKV zu kompensieren.“
Einnahmen reichen nicht mehr aus
Die finanzielle Schieflage der gesetzlichen Krankenkassen hat sich in den vergangenen Jahren verschärft. Im ersten Halbjahr 2025 stiegen die Ausgaben um 7,8 Prozent, während die Einnahmen – ohne Zusatzbeiträge – nur um 5,5 Prozent wuchsen.
Besonders teuer sind Arzneimittel, Pflegeleistungen, Krankenhausbehandlungen und ärztliche Vergütungen geworden. Hinzu kommt der demografische Wandel: Immer mehr ältere Versicherte beanspruchen kostenintensive medizinische Leistungen.
Gesundheitsökonomen warnen, dass diese Entwicklung langfristig zu Beitragssätzen von über 18 Prozent führen könnte, falls keine strukturellen Reformen eingeleitet werden.
Streit um Bürgergeldfinanzierung
Ein zusätzlicher Streitpunkt betrifft die Beiträge für Bürgergeldempfänger. Eigentlich müsste der Bund diese Kosten vollständig tragen. Nach Darstellung des GKV-Spitzenverbands geschieht das aber nicht. Der Verband wirft der Bundesregierung vor, die gesetzlich vorgesehene Finanzierung zu unterlaufen und damit die Solidargemeinschaft der Beitragszahler zu belasten.
Aus diesem Grund hat der Spitzenverband beschlossen, Klage gegen die Bundesregierung einzureichen. In der Begründung heißt es: „Seit Jahren werden die Krankenkassen nicht ausreichend refinanziert. Die Folgen tragen die Versicherten über steigende Beiträge.“
Prognosen: Keine Entlastung in Sicht
Ob der Beitragssatz tatsächlich stabil bleibt, ist ungewiss. Experten gehen davon aus, dass ein großer Teil der Kassen bereits im ersten Quartal 2026 neue Beitragserhöhungen beschließen wird. Versicherte müssen sich daher auf steigende Abzüge vom Gehalt einstellen.Die Zukunft der gesetzlichen Krankenversicherung hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingt, Kostensteigerungen im Gesundheitswesen einzudämmen und die Finanzierung der Sozialbeiträge gerechter zu gestalten. Bis dahin dürfte das Jahr 2026 für viele Versicherte ein weiteres Jahr steigender Belastungen werden.