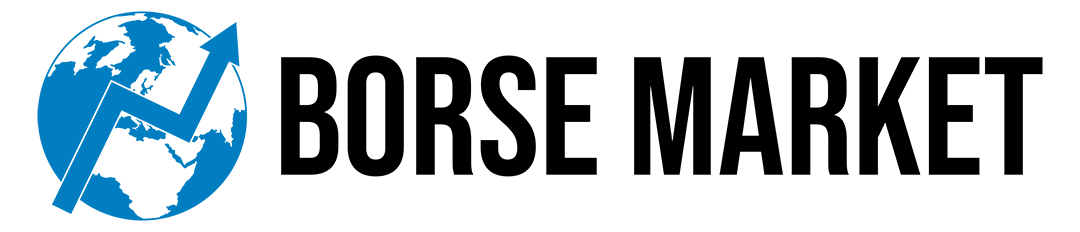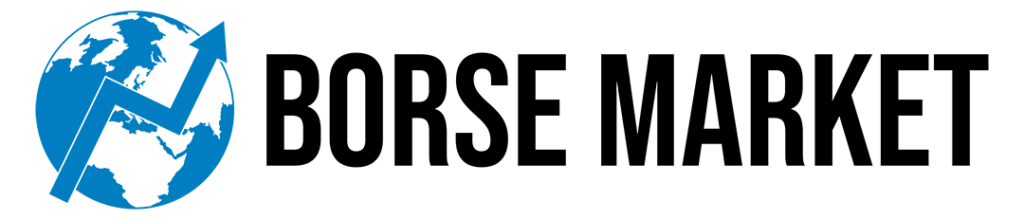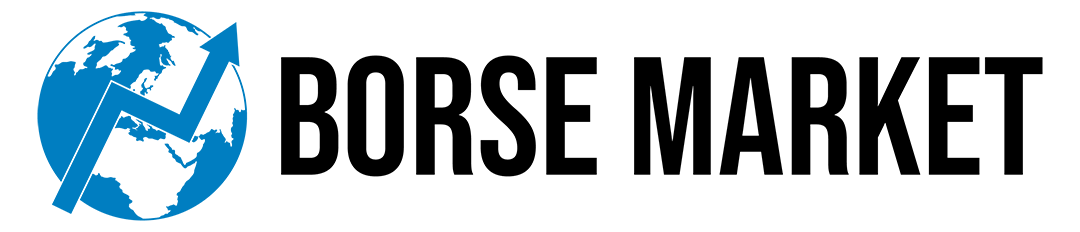Maschinenbau unter Druck: Salacher Unternehmen reagiert
Die EMAG-Gruppe aus Salach zieht die Konsequenzen aus der tiefen Krise der Werkzeugmaschinenindustrie und kündigt den Abbau von 455 Arbeitsplätzen in Deutschland an. Damit verliert nahezu ein Drittel der Belegschaft ihren Arbeitsplatz – ein Schritt, der selbst nach umfangreichen Spar- und Effizienzprogrammen nicht mehr abzuwenden war.
Die Branche erlebt derzeit eines der härtesten Jahrzehnte seit der Finanzkrise. Laut dem Verband Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) sank der Auftragseingang 2023 um 11 Prozent, 2024 um 19 Prozent und nochmals um 5 Prozent im ersten Halbjahr 2025. Diese Entwicklung zeigt, dass die schwache Nachfrage längst kein vorübergehendes Phänomen mehr ist, sondern sich zu einer strukturellen Krise verfestigt hat.
Nachfrageeinbruch im Inland trifft Hersteller hart
Besonders der deutsche Markt bleibt ein Sorgenkind. Die Inlandsbestellungen gingen im ersten Halbjahr 2025 um rund 17 Prozent zurück. Starke Einbußen verzeichneten vor allem Drehmaschinen und Bearbeitungszentren, zwei Kernprodukte der Branche. Viele Betriebe müssen mit Kurzarbeit, Kostenreduktionen und Produktionsanpassungen reagieren, um ihre Liquidität zu sichern.
„Die Auftragslage ist seit Monaten angespannt, und wir sehen keine kurzfristige Besserung“, heißt es aus Branchenkreisen. Der anhaltende Investitionsstau in der Industrie, gepaart mit gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen, verschärft die Lage zusätzlich.
Globale Spannungen bremsen den Export
Neben der schwachen Binnennachfrage belasten auch internationale Faktoren die Geschäfte. Neue US-Zölle, eine verlangsamte Wirtschaft in China und unsichere Investitionsentscheidungen in Europa erschweren das Exportgeschäft. Als global agierendes Unternehmen spürt EMAG diese Entwicklung besonders deutlich.
„Die Märkte sind gleichzeitig schwach geworden, das gab es in dieser Form selten“, berichten Branchenanalysten. Für Hersteller, die stark vom Auslandsgeschäft abhängen, bedeutet das sinkende Auftragsvolumina und steigenden Wettbewerbsdruck.
Maßnahmenpaket konnte Trend nicht aufhalten
Bereits in den vergangenen Jahren hatte EMAG umfassende Maßnahmen eingeleitet, um sich gegen den Abschwung zu stemmen. Dazu gehörten intensive Kurzarbeitsphasen, interne Effizienzprogramme, Prozessoptimierungen und Investitionen in Automatisierung und Retrofit-Technologien. Auch strukturelle Anpassungen an den Standorten wurden vorgenommen, um Abläufe zu verschlanken.
„Unser Ziel war es, das Unternehmen so aufzustellen, dass wir trotz schwieriger Märkte handlungsfähig bleiben“, erklärt die Geschäftsleitung. Doch trotz aller Bemühungen blieb der erhoffte Aufschwung aus.
455 Arbeitsplätze fallen der Neuausrichtung zum Opfer
Insgesamt beschäftigt EMAG derzeit 1.509 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen deutschen Standorten. Mit dem geplanten Abbau von 455 Stellen reduziert das Unternehmen seine Belegschaft erheblich, um Kapazitäten an das dauerhaft niedrigere Auftragsvolumen anzupassen.
Der Stellenabbau erfolgt im Rahmen einer strukturellen Neuausrichtung. Gemeinsam mit dem Betriebsrat wurde ein Sozialplan erarbeitet, der unter anderem die Einrichtung einer Transfergesellschaft vorsieht. Betroffene Beschäftigte sollen dort die Möglichkeit erhalten, sich neu zu orientieren und weiterzubilden.
Geschäftsführung spricht von „notwendiger Entscheidung“
Markus Clement, CEO der EMAG-Gruppe, betont die Schwere der Situation:
„Die aktuelle Marktsituation zwingt uns zu sehr schmerzhaften, aber unausweichlichen Schritten. Wir müssen unsere Strukturen anpassen, um langfristig bestehen zu können.“
Clement unterstreicht, dass es sich dabei nicht um eine kurzfristige Reaktion handelt, sondern um eine strategische Neuausrichtung. Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und die Organisation auf ein stabiles Fundament für die kommenden Jahre zu stellen.
Dauerkrise in der Werkzeugmaschinenbranche
Die Probleme, mit denen EMAG kämpft, sind kein Einzelfall. Auch andere namhafte Hersteller der Branche, darunter DMG Mori, Trumpf und Heller, verzeichnen rückläufige Bestellungen. Die Gründe reichen von der schwächelnden Bau- und Automobilindustrie über hohe Finanzierungskosten bis hin zu geopolitischen Unsicherheiten.
Laut dem VDW gilt die Werkzeugmaschinenbranche als „Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung“. Wenn hier die Zahlen einbrechen, folgt häufig auch eine Abkühlung in anderen Industriebereichen.
Zukunftsstrategie: Fokus auf Technologie und Automatisierung
Trotz der schwierigen Lage blickt EMAG nach vorn. Das Unternehmen will künftig verstärkt in technologische Innovationen, Automatisierungslösungen und Nachhaltigkeit investieren. Diese Bereiche gelten als Schlüsselfaktoren, um die Abhängigkeit von konjunkturellen Schwankungen zu verringern.
Parallel arbeitet EMAG an einer optimierten Kostenstruktur und effizienteren Prozessen. Damit soll das Unternehmen flexibler auf Auftragsänderungen reagieren können und seine operative Stabilität sichern.
Hoffnung auf Erholung bleibt bestehen
Ob sich die Märkte in den kommenden Jahren erholen, bleibt ungewiss. Viele Beobachter erwarten erst ab 2027 eine moderate Belebung der Nachfrage, vorausgesetzt, geopolitische Spannungen und Energiepreise stabilisieren sich.
Für EMAG ist der jetzt eingeleitete Umbau ein Schritt, um diese Zeit zu überstehen. Clement betont: „Wir wollen auch in schwierigen Zeiten ein verlässlicher Partner für unsere Kunden bleiben.“