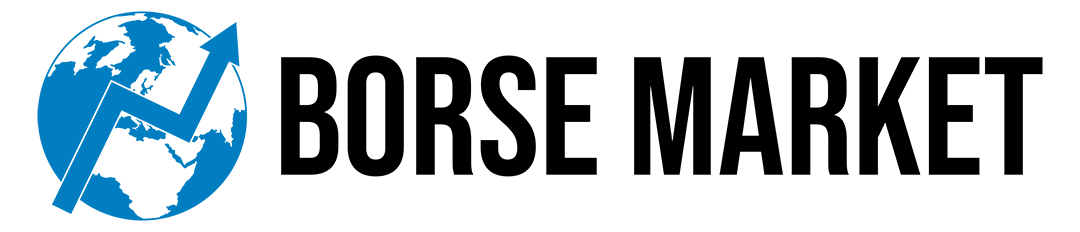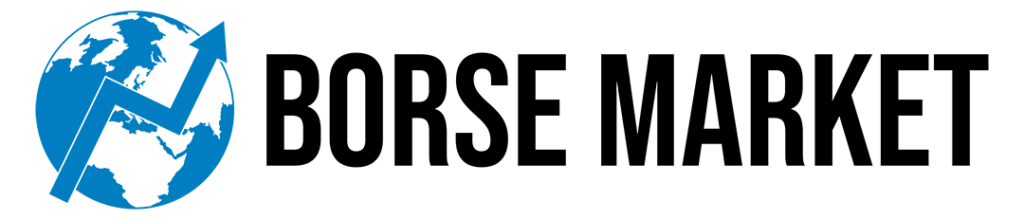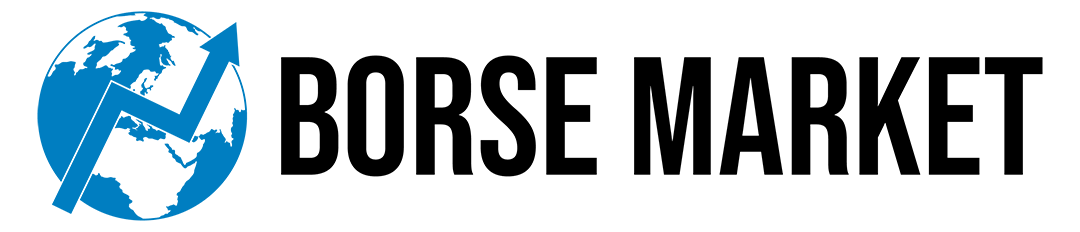EU-Kommission will Finanzrahmen massiv ausweiten
Mit dem Vorschlag eines langfristigen EU-Haushalts in Höhe von 2 Billionen Euro hat Ursula von der Leyen eine politische Debatte ausgelöst. Die neue Finanzplanung betrifft die Periode 2028 bis 2034 und liegt deutlich über dem aktuellen Rahmen, der bei rund 1,3 Billionen Euro liegt. Die Kommission will damit insbesondere Verteidigungsausgaben, digitale Infrastruktur und neue strategische Projekte finanzieren.
Deutsche Regierung lehnt Plan mit klaren Worten ab
Der Widerstand aus Berlin folgte prompt. Regierungssprecher Stefan Kornelius erklärte am Montag: „In Zeiten angespannter öffentlicher Finanzen ist ein solcher Sprung nicht vermittelbar.“ Laut Bundesregierung seien viele EU-Staaten derzeit gezwungen, eigene Haushaltsdefizite zu begrenzen, weshalb ein deutlich vergrößerter Gemeinschaftshaushalt politisch nicht tragbar sei.
Deutschland als Hauptfinanzierer besonders betroffen
Der deutsche Anteil am EU-Budget beträgt gegenwärtig etwa 25 Prozent. In absoluten Zahlen müsste Deutschland bei Umsetzung des Plans über die geplante Laufzeit Hunderte Milliarden Euro zusätzlich beitragen. In Berlin fürchtet man, dass diese Mittel entweder durch Einschnitte im nationalen Etat oder durch Steuererhöhungen kompensiert werden müssten – beides gilt als politisch heikel.
Brüssel schlägt neue Finanzquellen vor
Die Kommission will den Haushalt auch durch sogenannte Eigenmittel ergänzen. Hierzu gehören unter anderem eine Recyclingabgabe für Elektroschrott, die Besteuerung großer Konzerne sowie mögliche Abgaben auf digitale Dienstleistungen. Ziel ist es, den Druck auf die Haushalte der Mitgliedsländer abzufedern. Auch dieser Teil des Vorschlags stößt in Deutschland auf Ablehnung. Die Bundesregierung erkennt zwar die Notwendigkeit struktureller Anpassungen, lehnt die konkrete Ausgestaltung aber ausdrücklich ab.
Verhandlungen über Haushalt starten unter schwierigen Vorzeichen
Der Vorschlag von Kommissionspräsidentin von der Leyen geht nun in die Beratungsphase zwischen den EU-Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament. Angesichts der deutlichen Kritik aus mehreren Hauptstädten – allen voran aus Berlin – ist bereits jetzt absehbar, dass lange und zähe Verhandlungen bevorstehen. Der Vorschlag könnte somit noch erhebliche Änderungen erfahren, bevor ein Beschluss möglich ist.