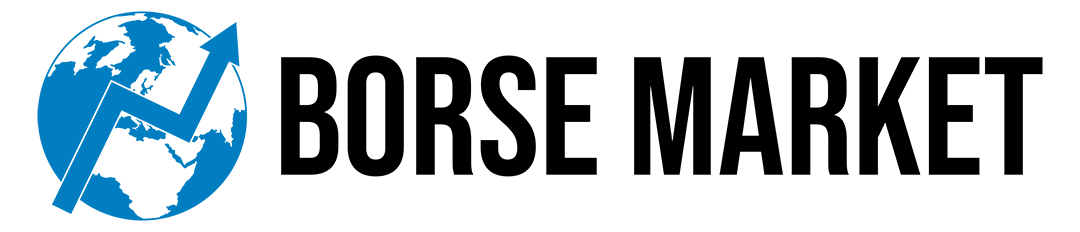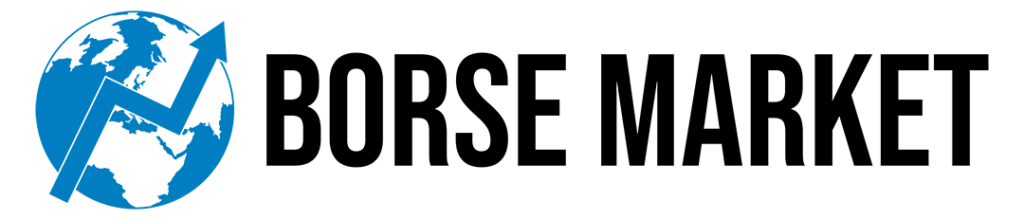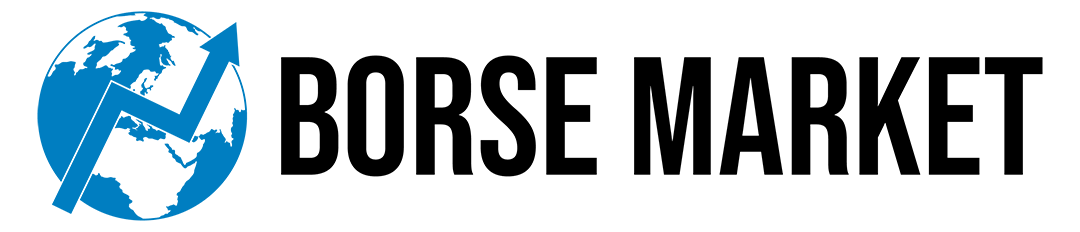Kein religiöses Recht vor Gericht: Wien greift durch
Die Bundesregierung in Österreich bereitet einen neuen gesetzgeberischen Schritt vor, der die Anwendung der Scharia in Rechtsstreitigkeiten künftig ausdrücklich ausschließen soll. Anlass ist eine Entscheidung eines Wiener Zivilgerichts aus dem Sommer 2025, die in Politik und Öffentlichkeit erhebliche Irritationen ausgelöst hatte. Bei einer zweitägigen Regierungsklausur ab Dienstag soll nun über eine entsprechende rechtliche Neuregelung beraten werden.
Der geplante Vorstoß versteht sich als politische Antwort auf einen Einzelfall, der sich rasch zu einer grundsätzlichen Debatte über Rechtsstaatlichkeit, religiöse Normen und staatliche Autorität ausgeweitet hat.
Ein Urteil mit weitreichender Signalwirkung
Im Zentrum der Kontroverse steht ein Beschluss des Wiener Landesgerichts für Zivilrechtssachen. Das Gericht hatte zugelassen, dass die Scharia als Grundlage für ein Schiedsgerichtsurteil in einem Vermögenskonflikt herangezogen werden darf. Rechtlich bewegte sich das Urteil innerhalb des bestehenden Schiedsrechts, politisch jedoch überschritt es aus Sicht vieler Beobachter eine sensible Grenze.
Kritiker sahen darin einen Präzedenzfall, der den Eindruck erwecken könne, religiöse Rechtsordnungen erhielten im staatlichen Rechtsraum faktisch Anerkennung. Diese Wahrnehmung setzte die Regierung unter Zugzwang, rasch und sichtbar zu reagieren.

Kanzler betont staatlichen Rechtsanspruch
Deutliche Worte kamen vom Bundeskanzler Christian Stocker. Der Vorsitzende der Österreichische Volkspartei erklärte unmissverständlich: „Es kann und wird in Österreich kein Kalifat geben.“ Damit machte Stocker klar, dass für ihn religiös begründete Rechtsnormen keinen Platz in staatlich anerkannten Streitbeilegungsverfahren haben dürfen.
Nach seiner Lesart müsse der Gesetzgeber eindeutig festschreiben, dass bei Rechtsstreitigkeiten ausschließlich das österreichische Recht gilt – auch dann, wenn sich Parteien freiwillig auf andere Regelwerke berufen wollen.
Teil einer breiteren politischen Agenda
Das Thema Scharia-Verbot ist eingebettet in eine umfassendere innenpolitische Strategie. Bei der Klausur in Mauerbach bei Wien stehen neben wirtschafts- und industriepolitischen Fragen auch Asyl, Migration und gesellschaftliche Integration auf der Tagesordnung. Die Regierungskoalition verfolgt dabei einen Kurs, der zunehmend auf rechtliche Abgrenzung und klare Symbole setzt.
Ein Beispiel ist das bereits beschlossene Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren, das ab 2026 gelten soll. Zusammengenommen senden diese Maßnahmen ein Signal der Härte, das sowohl nach innen als auch nach außen wirken soll.
Kritik: Gesetzgebung als politisches Zeichen
Aus der Wissenschaft kommt jedoch scharfe Kritik. Die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle bezeichnete das geplante Scharia-Verbot als überwiegend symbolischen Akt. Gegenüber der Tageszeitung Der Standard sagte sie: „Das ist ein sehr symbolischer Schritt in einem emotional stark aufgeladenen Feld.“
Nach ihrer Einschätzung werde mit dem Vorhaben weniger ein reales rechtliches Problem gelöst, sondern vielmehr ein politisches Narrativ bedient. Die ÖVP versuche damit, Handlungsfähigkeit zu demonstrieren und sich zugleich gegenüber der Freiheitliche Partei Österreichs abzugrenzen, die seit Jahren mit migrations- und identitätspolitischen Themen punktet.
„Null Toleranz“ als strategisches Leitmotiv
Stainer-Hämmerle sieht hinter dem Vorstoß vor allem ein strategisches Kalkül. „Die ÖVP will zeigen, dass sie liefert und ihrem Anspruch von ‚Null Toleranz‘ gerecht wird.“ Damit werde jedoch suggeriert, es existiere ein strukturelles Problem, das in dieser Form bislang nicht nachweisbar sei.
Tatsächlich seien staatliche Gerichte bereits heute strikt an die Verfassung gebunden. Der Wiener Fall habe sich im Rahmen privater Schiedsgerichtsbarkeit abgespielt und bedeute keine generelle Öffnung des Rechtsstaats für religiöse Normen.
Zwischen Rechtsklarheit und politischem Signal
Unabhängig von der Bewertung steht fest, dass der Präzedenzfall eine empfindliche Leerstelle im öffentlichen Bewusstsein offengelegt hat. Die Frage, wie weit private Schiedsverfahren gehen dürfen und wo der Staat klare Grenzen ziehen muss, berührt zentrale Prinzipien von Säkularität, Rechtssicherheit und gesellschaftlichem Zusammenhalt.
Mit dem geplanten Gesetz will die Regierung diese Grenze unmissverständlich markieren. Kritiker hingegen warnen davor, das Recht mit symbolischen Verboten zu überfrachten und damit neue gesellschaftliche Spannungen zu erzeugen. Der Konflikt zeigt, wie schnell juristische Einzelfälle zu politischen Stellvertreterdebatten werden können.